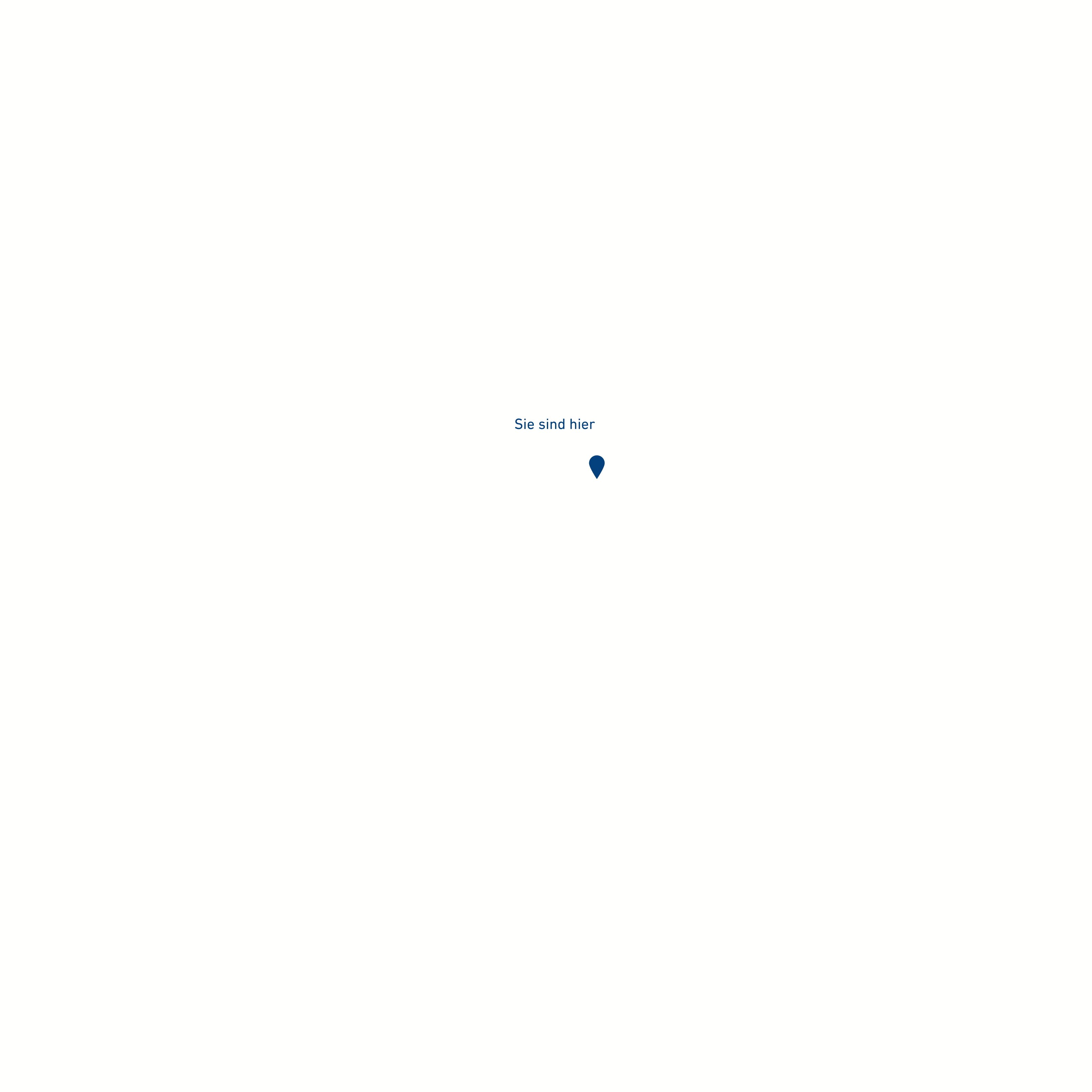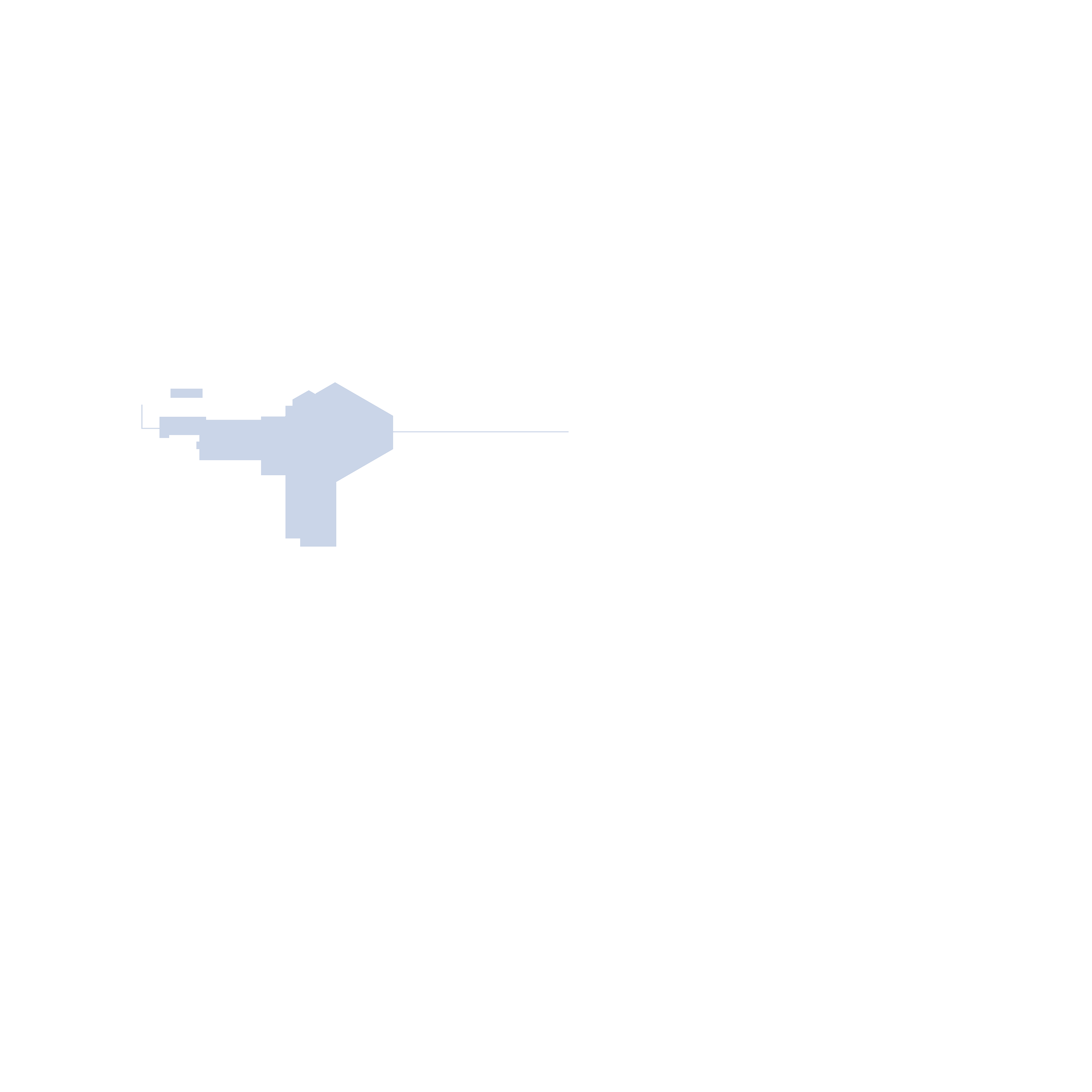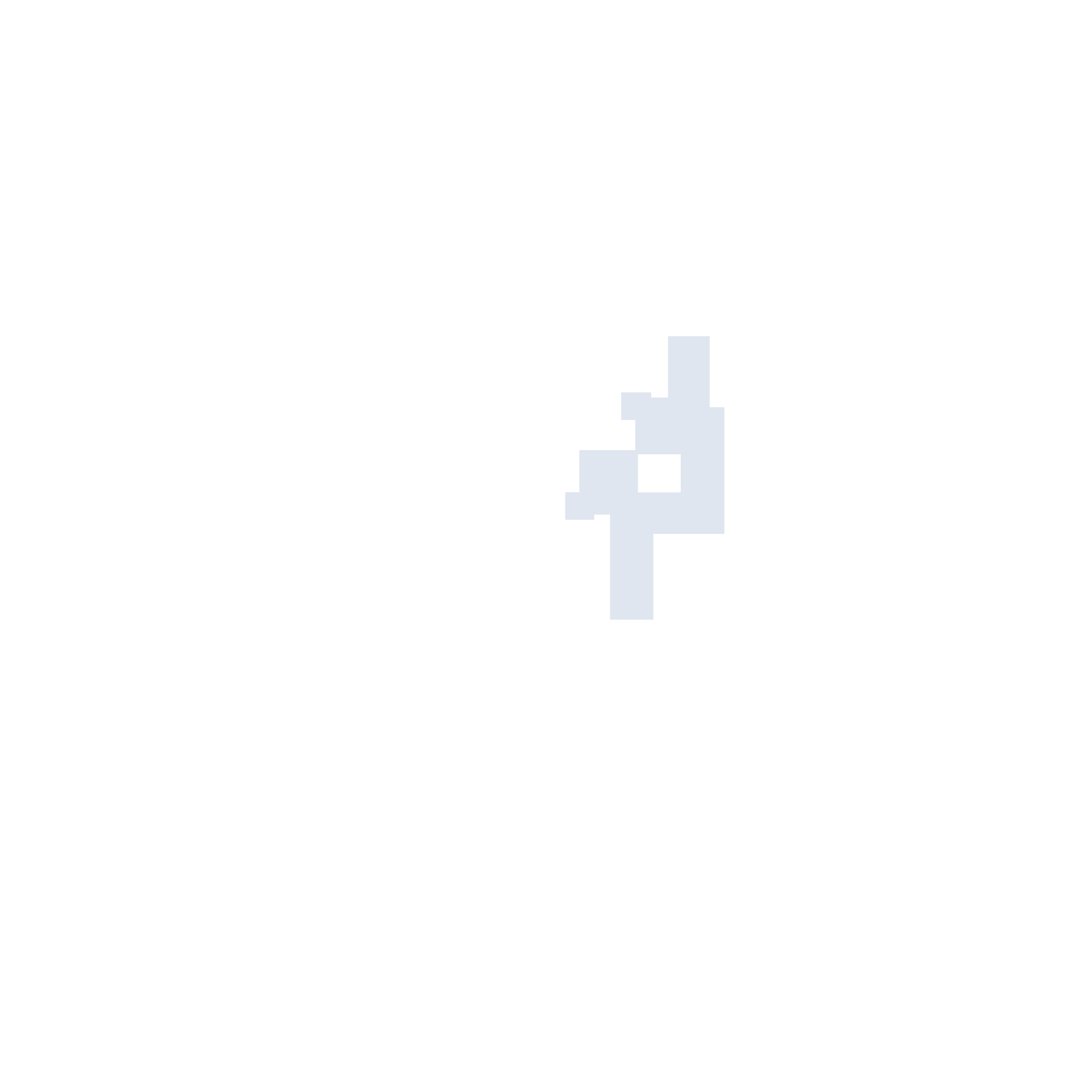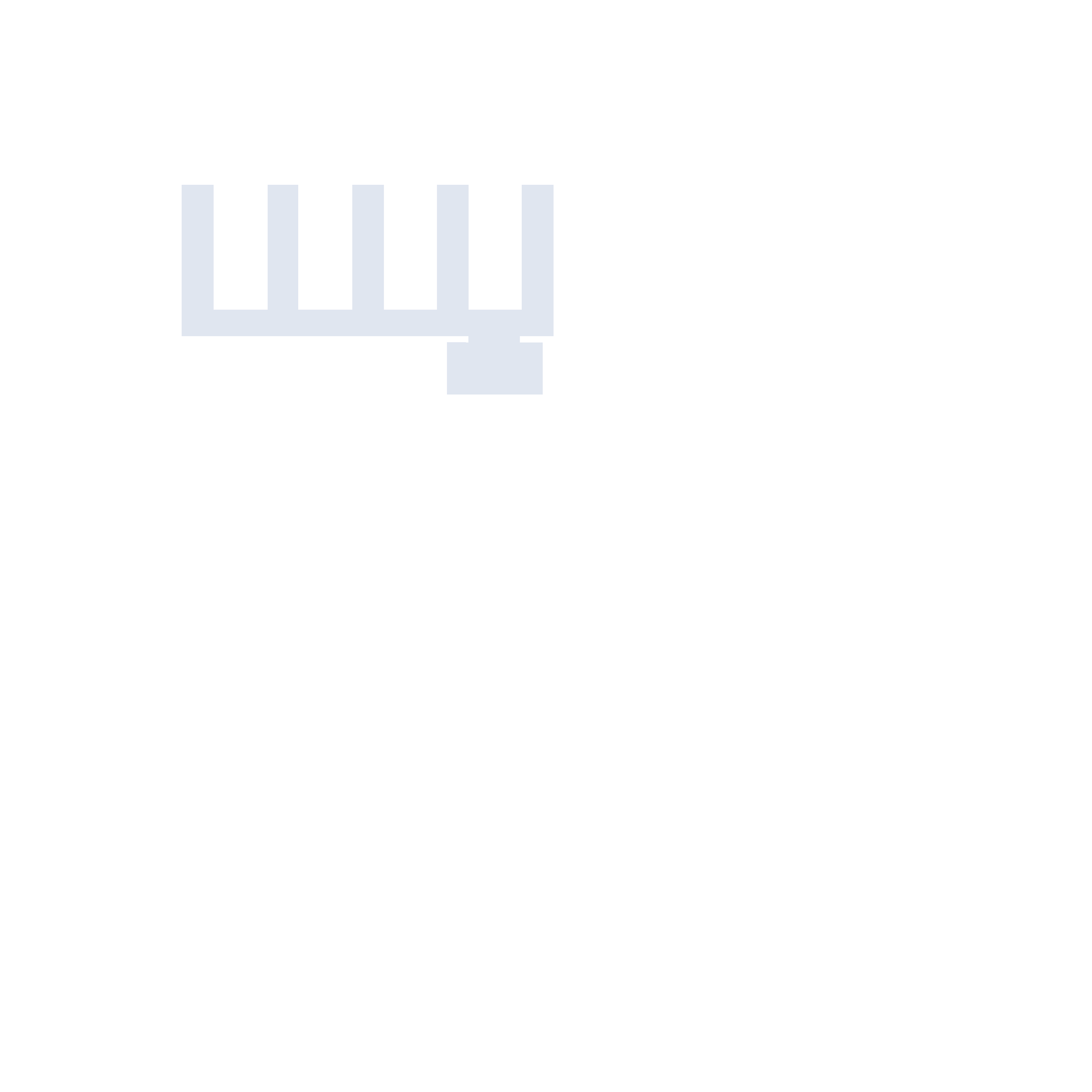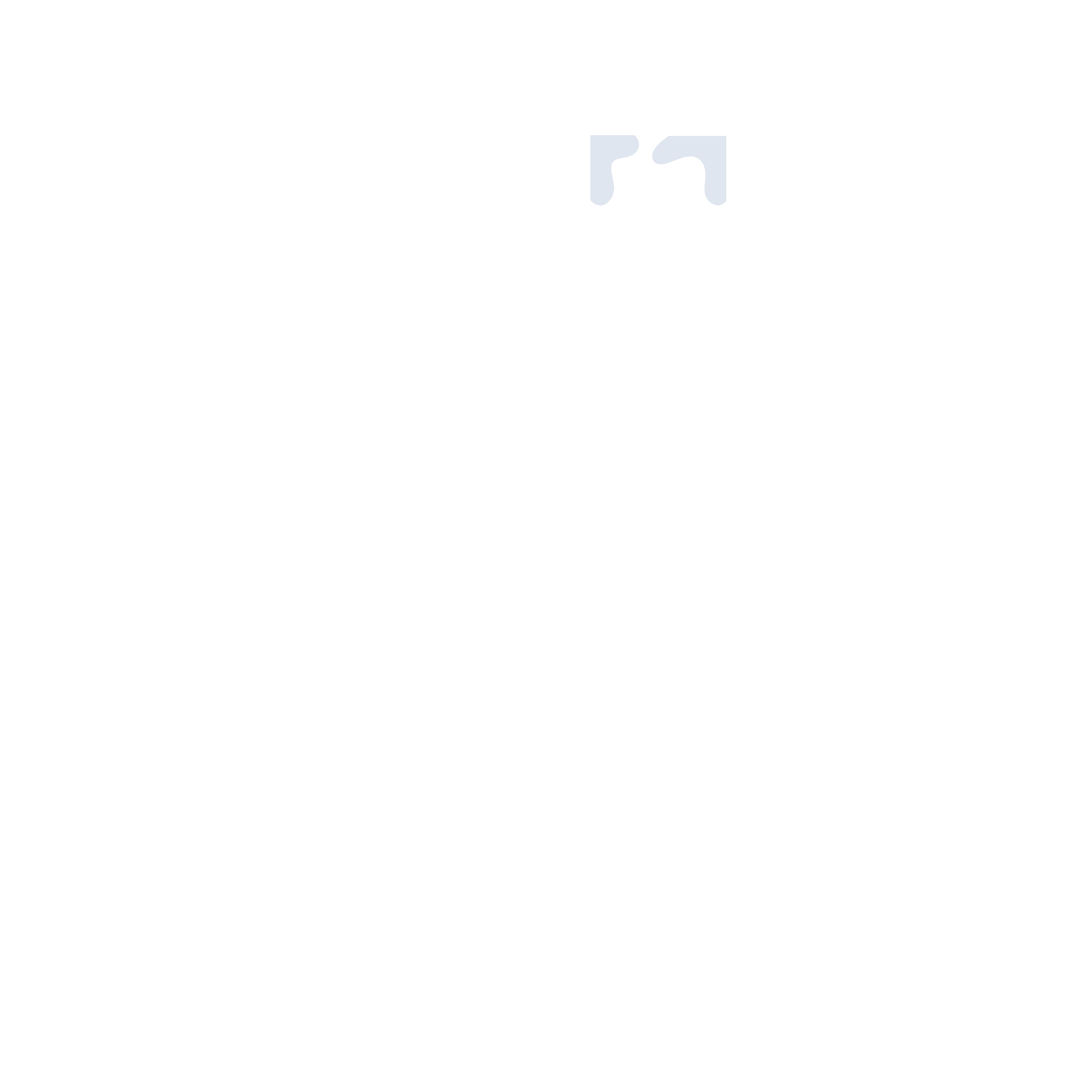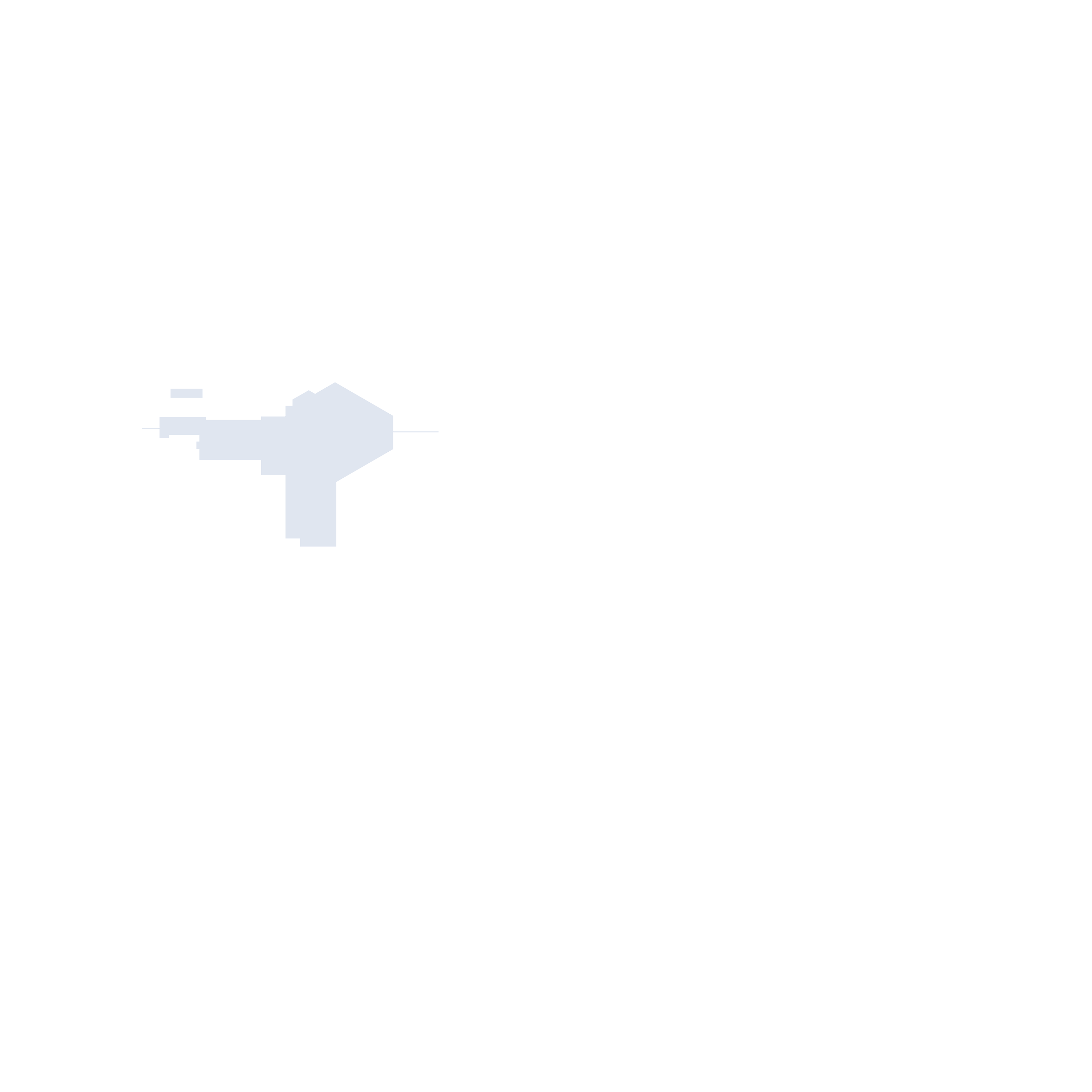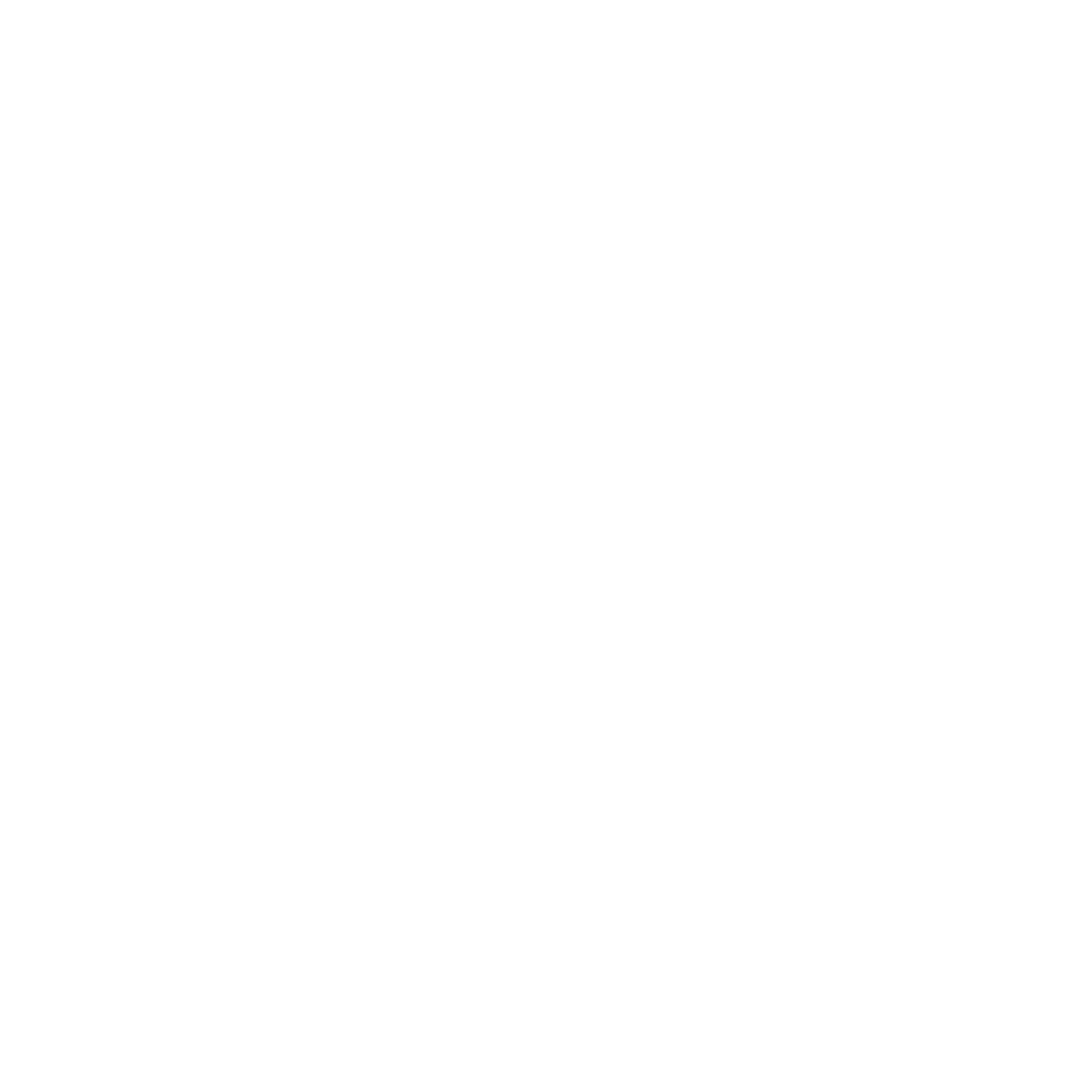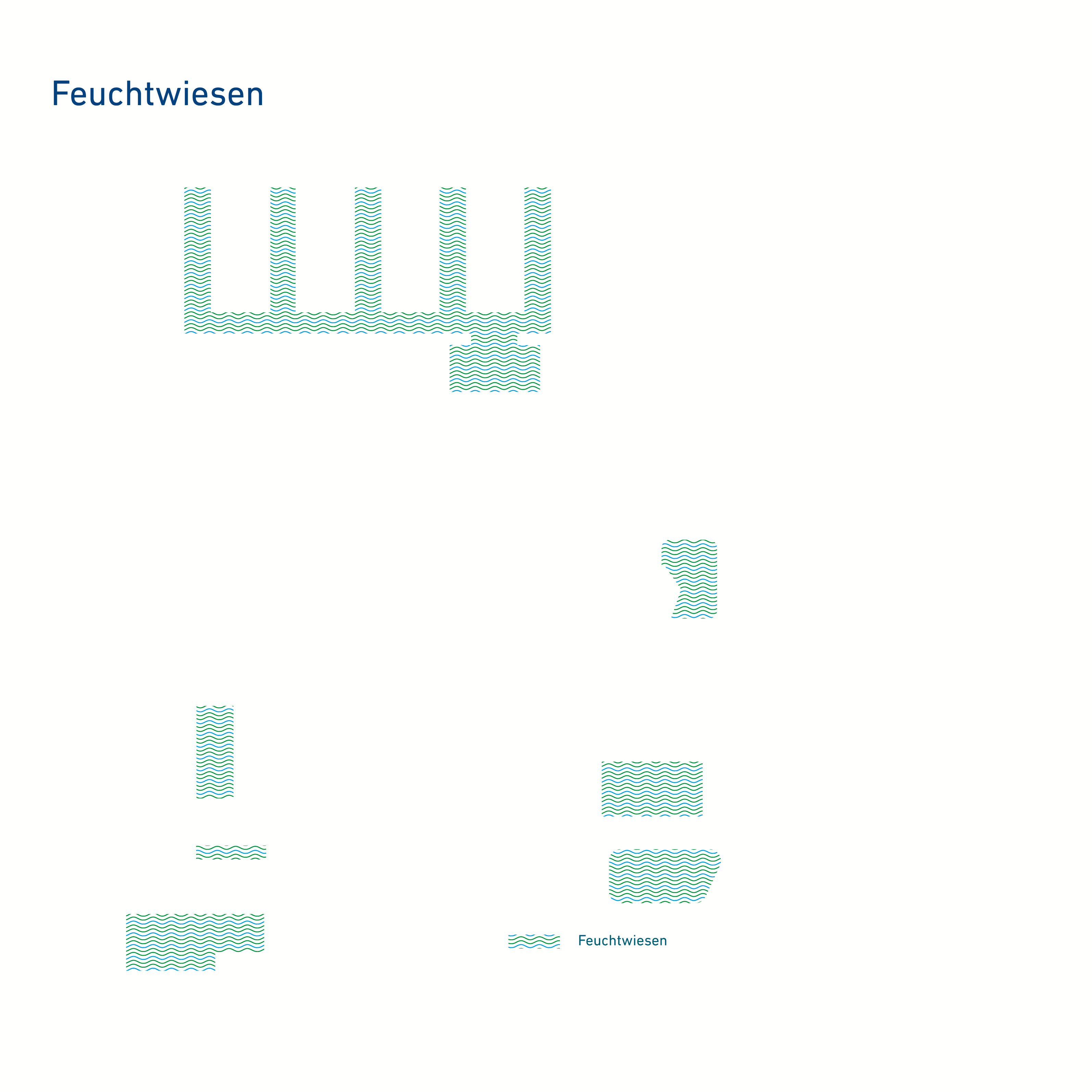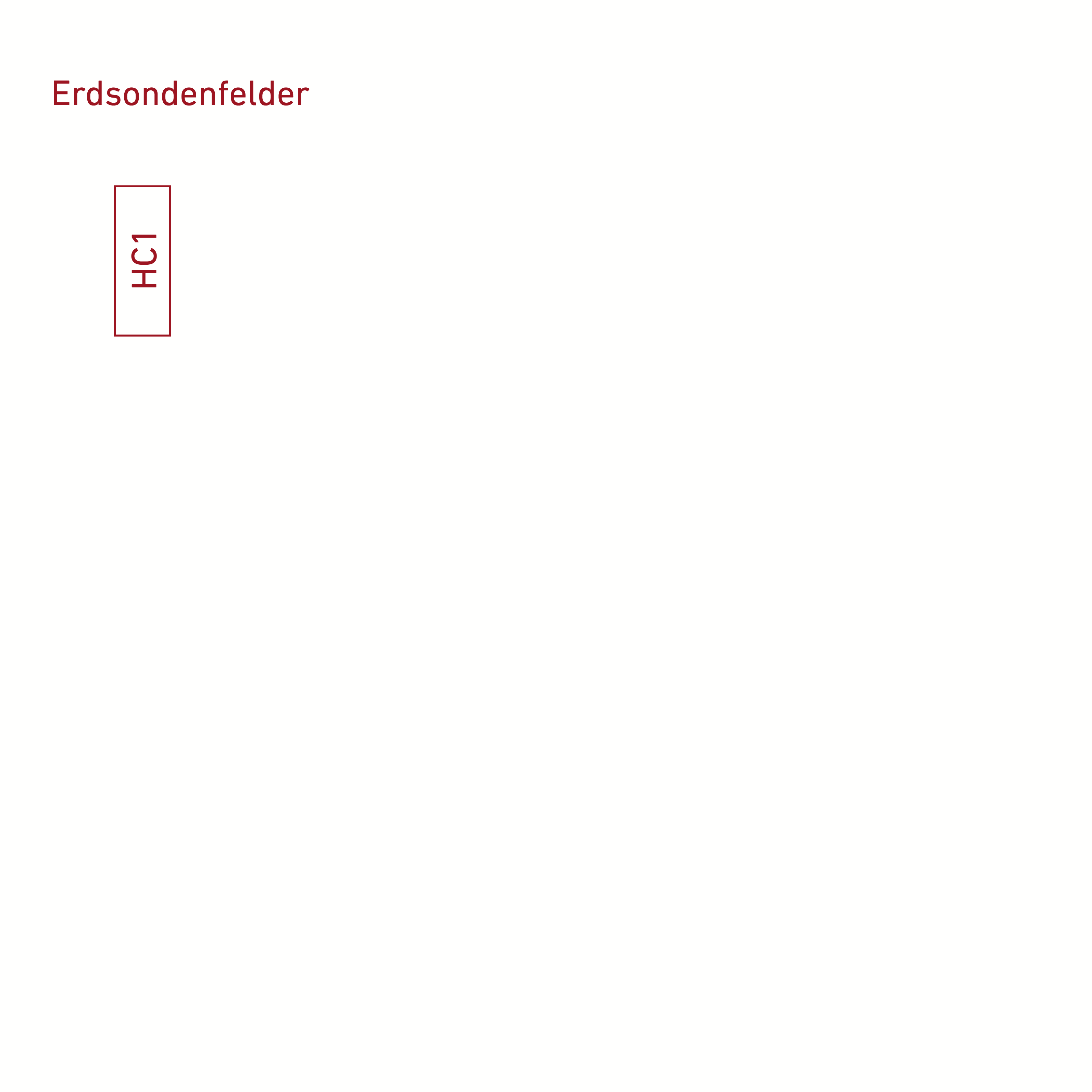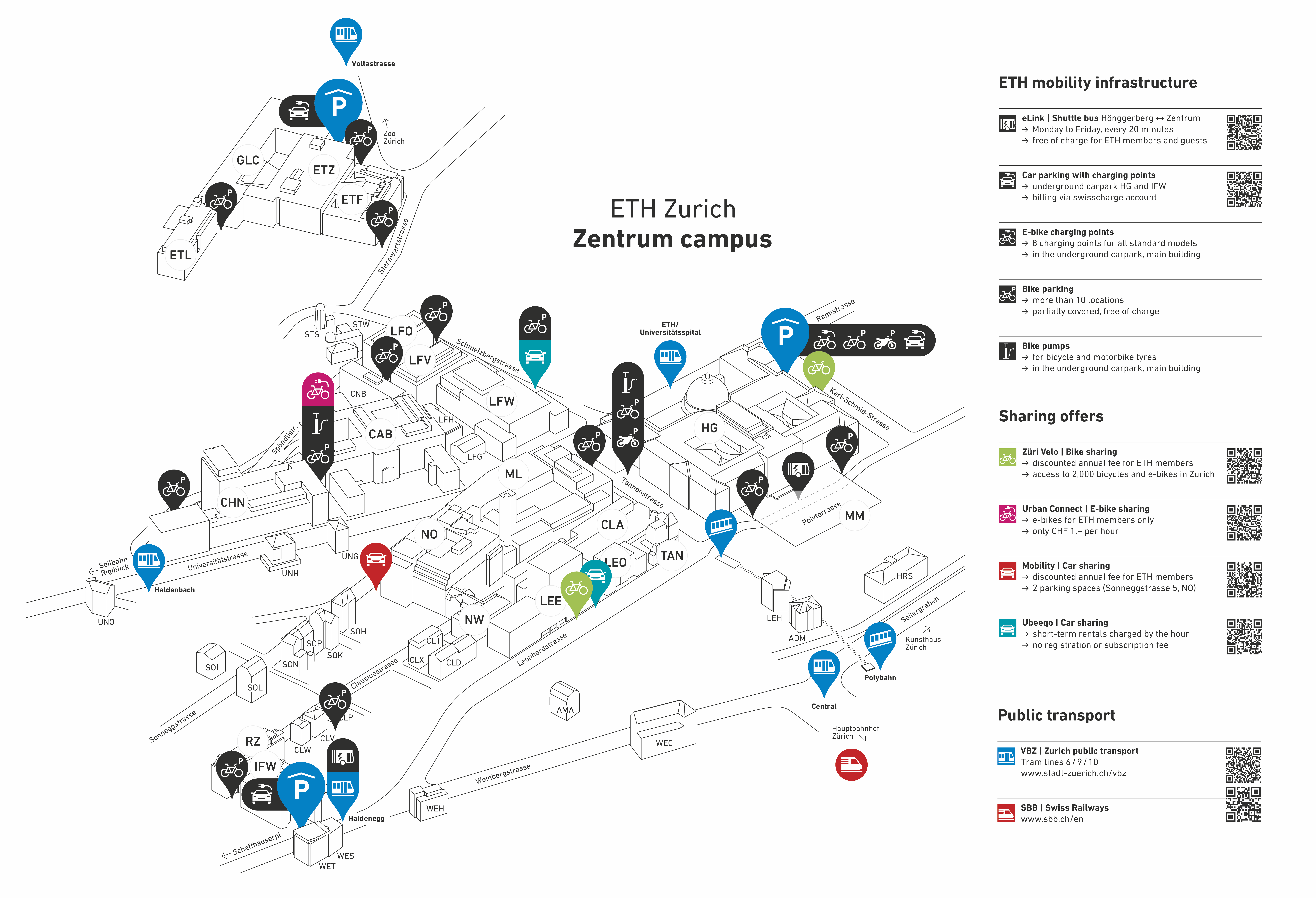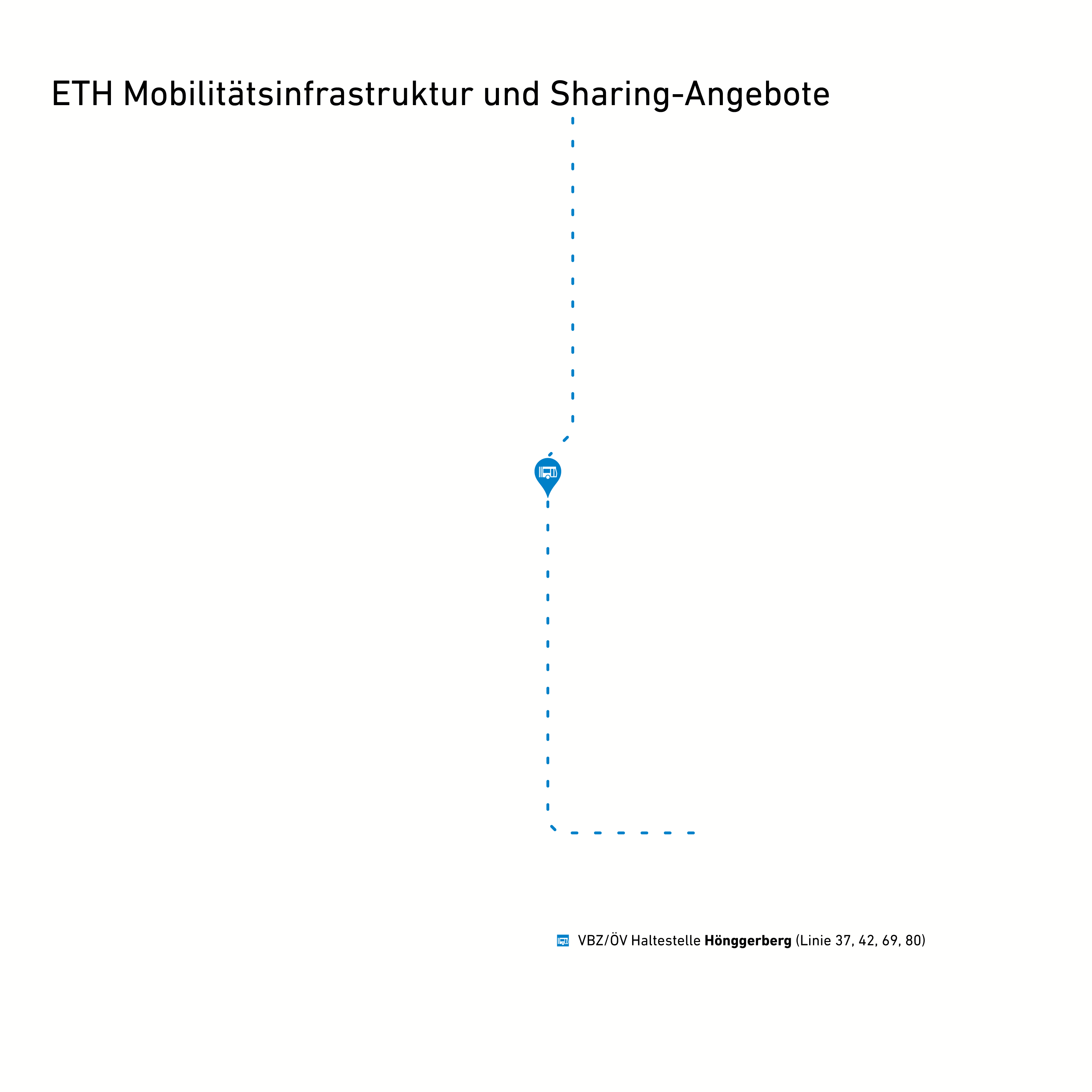Willkommen auf dem Campus Hönggerberg
Willkommen auf dem Campus Hönggerberg
Hightec zwischen Wäldern und Wiesen: willkommen auf dem lebendigen Campus ETH Hönggerberg!
Um 1924 sendete der erste Radiosender der Schweiz vom Hönggerberg. Damals waren die zwei Radiotürme umgeben von Landwirtschaft. Seit die ETH 1959 den damaligen Grundbesitzern Land abkaufte, wächst und gedeiht der Campus. Ihr Knopfdruck bestimmt, ob auf dem Modell die gebaute Infrastruktur aufleuchtet, oder die verschiedenen Gärten als Teil der Landschaftsarchitektur.Machen Sie die Gebäude der Zukunft sichbar, entdecken Sie die Habitate von Wildbienen und Fledermäusen oder finden Sie das Restaurant Ihrer Wahl unter:
→ Gebaute Infrastruktur
→ Geplante Infrastruktur
→ Nachhaltiger Campus
→ Campus entdecken